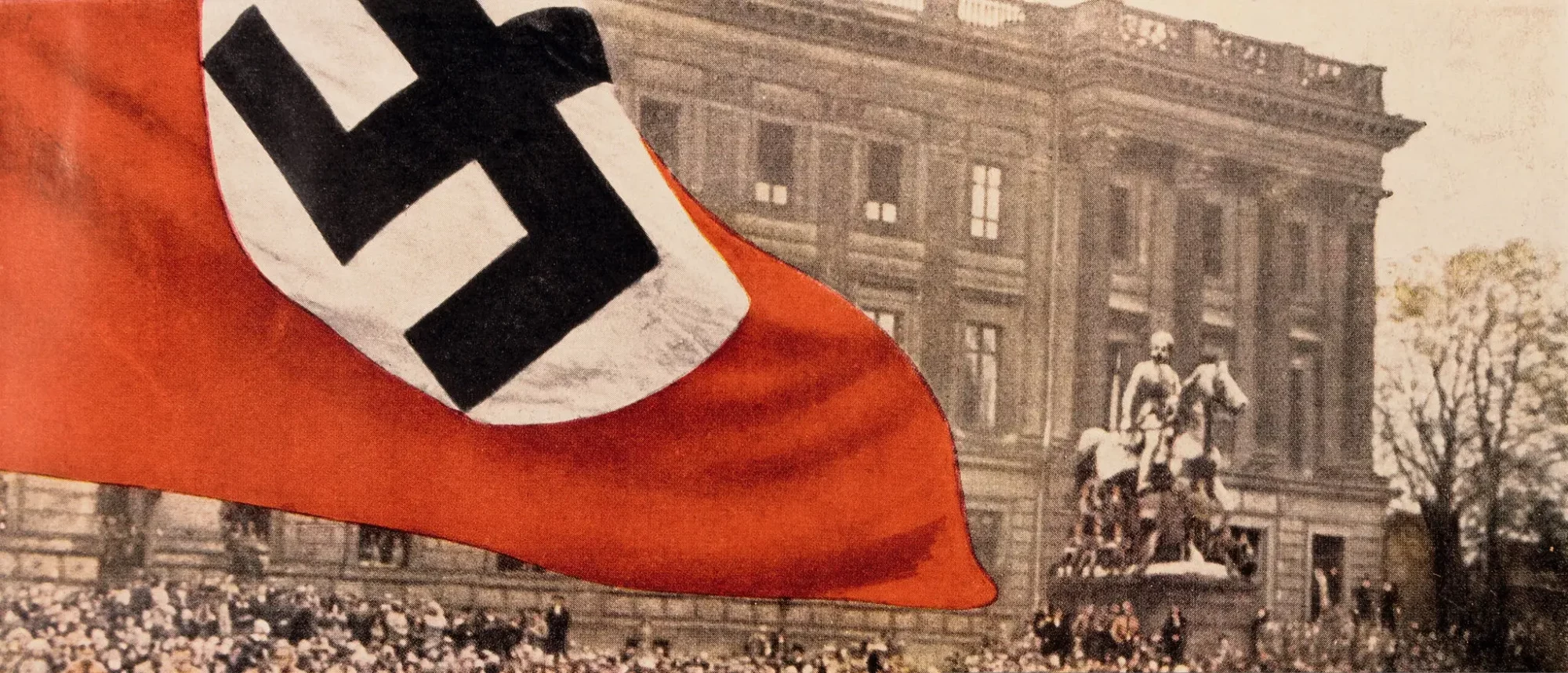„3. Januar 1947.
Prozessakten, Public Record Office, London (Übersetzung der englischen Originale durch J.K.)
Am zweiten Tag macht Piere Corneille Theodore Verhaegen nach der Vereidigung die folgende Aussage: „Ich bin belgischer Staatsbürger, wohne in Gent und bin am 3. August 1923 geboren. Zur Zeit studiere ich Jura. Als mein Bruder 1942 nach England flüchtete, verhafteten mich die Deutschen, ließen mich aber nach einiger Zeit wieder frei. Weil sie danach Papiere der Widerstandsbewegung bei mir fanden, wurden mein Vater und ich am 4. August 1944 erneut verhaftet und ins Gefängnis von Ghent gebracht. Am 3. September darauf trafen wir im Konzentrationslager Neuengamme ein. Mit einer Gruppe von ungefähr 150 Gefangenen kamen wir am 9. September in Schandelah an. Zum Zeitpunkt unserer Ankunft arbeiteten hier bereits schätzungsweise 300 bis 350 Gefangene. Danach stieg die Zahl der Gefangenen ständig an und erreichte im April 1945 nach der Ankunft der 500 aus dem Außenlager Porta evakuierten Gefangenen die Zahl von ungefähr 1200 Menschen. Bewacht wurden wir von SS-Männern. Der Lagerkommandant hieß Ebsen, sein Stellvertreter Truschel. Schiefelbein kenne ich als Leiter der Arbeitskolonne „Abladen“. Grosse hat uns bei der Ankunft mit den Worten; „Ihr kommt alle ins Krematorium.“ begrüßt. Diesen Satz hörten wir oft besonders von den Kapos in Neuengamme und Schandelah. Die erste Woche war ich in Block l untergebracht. Wir konnten dort nur auf dem Fußboden schlafen, weil die Betten noch nicht fertig waren. Wir hatten nur Decken und Strohsäcke. Danach kam ich in Block 2, und nach der Fertigstellung Ende Oktober, in Block 3. Diese Baracke war größer als die anderen, nach meiner Schätzung hatte sie eine Grundfläche von ungefähr 40 x 12 Metern. Block l und 2 waren nur ungefähr 10 x 25 Meter groß. Hoch waren die Baracken ungefähr drei Meter. Nach meiner Erinnerung waren unter den Gefangenen die folgenden Nationalitäten vertreten: 125 bis 150 Belgier, 50 bis 70 Franzosen, ungefähr 10 Spanier, 20 bis 30 Deutsche, 80 Dänen, 10 Italiener, 10 Griechen, um die 50 Polen, über 150 Russen, bis zu 50 Letten, einige Tschechen und Jugoslawen und ein Chinese.
Alle Nichtdeutschen waren politische Gefangene und trugen zur Kennzeichnung auf der Kleidung einen roten Winkel. Von den Deutschen waren nur wenige aus politischen Gründen eingesperrt, es waren hauptsächlich kriminelle Gefangene; sie trugen einen grünen Winkel. Zwei Deutsche waren Zeugen Jehovas, sie trugen den lila Winkel. Die Gesamtzahl der Gefangenen variierte ständig. Viele starben, und die als unheilbar geltenden Kranken wurden zum Sterben nach Neuengamme zurückgebracht. Ich erinnere mich an zwei solche Transporte im November 1944, und im darauffolgenden Februar betraf das 80 Männer. Darunter war auch ein Freund von mir gewesen; er ist in Neuengamme gestorben. Unsere Baracken waren mit elektrisch geladenem Stacheldraht umgeben, der ungefähr 1,80 Meter hoch war. Innerhalb des eigentlichen Gefangenenlagers standen Block l, 2 und 3 und die Revierbaracke. Östlich davon lagen die Unterkunftsbaracke der SS-Wachmannschaft und die Küchenbaracke. Ein halbfertiges Gebäude neben der SS-Baracke sollte schnellstens fertiggestellt werden. Darum mußten immer ungefähr 100 Gefangene nach Feierabend, teilweise auch unter Scheinwerferlicht – daran weiterbauen. Warum dieses Gebäude dann doch nicht fertiggestellt wurde, weiß ich nicht. Die nördlich der Durchgangsstraße gelegenen Steinbaracken waren bei meiner Ankunft noch im Bau.
Die vier Baracken des Gefangenenlagers konnten beheizt werden. In Block l und 2, in denen jeweils 200 Gefangene lagen, standen je zwei Öfen. Im Revierblock gab es fünf oder sechs Öfen. Trotz der Öfen hatten wir jedoch selten Heizmaterial. Mit Erlaubnis der Kapos und sogar der SS, aber entgegen der Anordnungen der zivilen Angestellten, stahlen wir Heizmaterial an unseren Arbeitsplätzen. Brachte man mittags oder abends ein Stück Kohle von der Arbeit mit ins Lager, bekam man vom Kapo eine zusätzliche Portion Suppe. Anfangs lag der Hauptarbeitsbereich westlich des Lagers und war durch Wachtürme der SS markiert. Diese Fläche erweiterte sich ständig.
Zuerst wurde ich einem Arbeitskommando zugeteilt, das „Staatsbahn“ genannt wurde. Acht Wochen lang mußte ich hier am Bau einer Eisenbahnverbindung vom Bahnhof Schandelah nach Wohld arbeiten. Der Leiter dieses Kommandos war der Kapo Grosse, der mit uns als Gefangener aus Neuengamme hier her gekommen war. Ein Kapo war ein (meistens krimineller) Gefangener, der zum Vorgesetzten anderer Gefangener ernannt worden war. Der Unterschied zwischen Kapos und Gefangenen war groß. Die Kapos brauchten nicht zu arbeiten, hatten immer ausreichend zu Essen und waren auch mit Zigaretten gut versorgt. Sie erhielten bessere Kleidung und schliefen zwar auch in den Gefangenenblocks, allerdings mit dem Unterschied, dass sie Einzelzimmer besaßen.
Die Arbeit im Kommando „Staatsbahn“ begann damit, dass wir auf einer Breite von ungefähr eineinhalb Meter die Erde planieren mußten. Darauf errichteten wir eine Art Damm, auf dem die Schwellen gelagert wurden. Eine Schwelle mußte ein Gefangener immer allein tragen. Auf den Schwellen befestigten wir die 4 bis 5 Meter langen Eisenbahnschienen, die immer von drei oder vier Gefangenen herangeschleppt werden mußten. Außer Spitzhacken und Schaufeln standen uns keine weiteren Werkzeuge zur Verfügung. Nach einem achttägigen Aufenthalt im Lazarett mit Bronchitis mußte ich in der Tischlerei arbeiten. Hier traf ich einen Tschechen als Vorarbeiter. Im November kamen der Kapo Schmidt und ein Zivilangestellter als Werkstattleiter dazu. Da ich kein Fachmann war, mußte ich einfache Holzverschalungen für die Betonierungsarbeiten herstellen. Diese Arbeit war nicht sehr schwer, konnte aber nur draußen in der Kälte durchgeführt werden. Im Schiefertagebau mußte ich nur einen Tag lang arbeiten. Dort wurde zunächst der Abraum weggeschaufelt, um an den Ölschiefer zu gelangen. Dann wurde er mit Spitzhacken zerschlagen und mit Loren abtransportiert.
Im September und Oktober standen wir zwischen 5.30 und 6 Uhr auf. Im Winter war es etwas später. Zur Arbeit gingen wir aber immer noch während der Dunkelheit. Das Frühstück bestand aus einer Scheibe Brot und einem viertel Liter einer warmen Flüssigkeit. Nach der Rückkehr zur Mittagspause erhielten wir ungefähr einen Liter Suppe, die meistens aus Rüben, Mohrrüben oder Kohl bestand. Sonntags schwammen in der Suppe im Unterschied zu sonst auch Kartoffeln in der Flüssigkeit. Fleisch enthielt die Suppe nicht. Manchmal fanden wir darin einige Knochen, die vom Fleisch für die SS-Leute übrig geblieben waren. Wohlschmeckend war die Suppe nicht; wir mußten das essen, was sie uns gaben.
Nach der Rückkehr von der Arbeit gegen 19 Uhr, im Winter zwischen 17 und 18 Uhr, bekamen wir ein Stück Brot, das zwischen 200 und 250 Gramm schwer war. Jede Woche erhielten wir zusätzlich ein Stück Margarine in der Große eines Fingers, einen Löffel voll Marmelade oder ein kleines Stück Wurst, manchmal auch ein Stück Käse. Mittwochs erhielten wir noch einen halben Liter Suppe dazu. Wir mußten jeden Sonntagvormittag arbeiten, manchmal auch nachmittags. Am ersten Weihnachtstag 1944 wurden wir von einer sehr guten Suppe überrascht, die von Wildfleisch gekocht war, das die SS geschossen hatte. Dazu gab es noch gebackene Kartoffeln. Unser Eßgeschirr bestand nur aus einem Löffel. Der Besitz von Messern war streng verboten. In jedem Block gab es eine begrenzte Anzahl von Keramik- oder Blechbechern, die bei der normalen Blockbelegung nicht für alle Gefangenen ausreichten. Zum Abwasch konnten wir aus einem Brunnen, der zwischen den Blocks l und 2 lag, ungefähr vier Eimer Wasser entnehmen. Oft war der Brunnen jedoch trocken und im Winter war das wenige Wasser meistens gefroren.
In der Kantine standen die Tische sehr eng zusammen. Nicht jeder Gefangener fand dort einen einen Sitzplatz. Oft mußten sich drei Männer auf zwei Stühle setzen.
In Neuengamme war ich mit einem ärmellosen Unterhemd, einer langen Leinenunterhose, blau-weiß gestreifter Hose und Jacke aus Leinen und einer Mütze versorgt worden. Ich hatte keine Strümpfe, aber Segeltuchschuhe mit einer Holzsohle. Die Unterhemden der meisten Gefangenen waren eigentlich Frauenunterhemden. Im November bekamen wir dickere Jacken und Hosen, später auch noch Mäntel aus dem gleichen Stoff, wie die Gardinen hier im Gerichtssaal. Die Pullover und Fausthandschuhe, die sie uns gaben, hielten uns nicht besonders warm. Anstatt richtiger Strümpfe mußten wir uns ungefähr 30 Zentimeter im Quadrat große Stofflappen um die Füße wickeln. Weil so viele Gefangene an Ruhr litten, bekamen wir auch so eine Art Bauchbinde.
Offiziell haben wir Unterwäsche zum Wechseln nie bekommen. Im Revierblock lag das sogenannte Kleiderlager, das von einem russischen Gefangenen betreut wurde. Nach Feierabend konnte man hingehen und um andere Kleidung bitten. Meistens aber verweigerte der Russe die Ausgabe anderer Kleidungsstücke. Er verstand entweder nicht, was man sagte, oder man gehörte nicht zu seinem Freundeskreis.
Zum Waschen konnten wir unsere Wäsche nicht geben, weil es keine Wäscherei gab. Natürlich hätten wir unser Zeug draußen waschen können, aber dann nur nackt in der Eiseskälte. Während meines Lazarettaufenthaltes wurde meine Unterwäsche sehr verschmutzt. Ich bat den Russen deshalb um andere Unterwäsche. Er brüllte mich an „Hau ab, du dreckiger Hund!“ und scheuchte mich weg.
Vom ersten Tag an stopften wir leere Zementtüten zwischen unsere Kleidung. Weil sich die Zivilangestellten darüber beschwerten, wurde uns die Benutzung der Zementtüten verboten. Weil man alles tun mußte, um sich wenigstens einigermaßen warm zu halten, hielten sich einige Gefangene nicht an diese Anordnung. Sie wurden geschnappt und von den Kapos mit einer kurzen Gummipeitsche fürchterlich verprügelt. Die Kapos sagten, das es auf Befehl Ebsens für das Benutzen der Zementtüten die Prügelstrafe gibt. Bevor wir unsere Fußlappen erhielten, hatten sich einige Gefangene vom Dach des Zementschuppens ein rot-weiß gestreiftes Material abgeschnitten. Sie wurden von Zivilangestellten denunziert und anschließend ohne Warnung verprügelt. Das habe ich selber gesehen.
Im Block l lag der Kantinenraum. Daneben arbeitete in einem kleinem Raum Ebsens Sekretär, ein Zeuge Jehovas. Block 2 diente als Unterkunft für Gefangene. Am Eingang lag ein Raum für die Kapos und den Blockältesten. Mitten durch die Baracke führte ein ungefähr 1,50 Meter breiter Gang. Zu beiden Seiten lagen eng aneinandergedrängt in fünf Reihen die Betten. Nur an den Fenstern konnte man zwischen die Bettreihen gehen. Hatte jemand sein Bett mittendrin, konnte er es nur erreichen, indem er über die anderen Betten kletterte.
Der Revierblock war in mehrere Räume unterteilt. Ein Raum diente den Köchen und der Ordonnanz des Lagerkommandanten als Unterkunft. Je ein weiterer Raum gehörte dem Schneider, dem Schuhmacher und dem Lagerältesten. Ein Raum war für zwanzig Gefangene reserviert, die besondere Arbeiten ausführten. Mir ist nicht bekannt, warum sie besondere Privilegien hatten. Das Lazarett bestand aus einem großen Schlafsaal, einem besonderen Raum für die Schwerkranken und dem sogenannten Operationszimmer. Die letzteren beiden Räume waren gewöhnlich gut beheizt.
Sanitäre Einrichtungen waren anfangs kaum vorhanden. Solange die Wasserleitung noch nicht gebaut war, wurde einmal pro Woche eine Tonne mit ungefähr 150 Liter Wasser gefüllt. Die Tonne stand auf einem Gerüst in der Nähe der Latrine. Das Wasser reichte nie aus. Die Kapos und andere „feine Herren“ des Lagers konnten sich bevorzugt mit Wasser versorgen. Wenn überhaupt kein Tropfen mehr übrig war, kam es schon vor, dass ich mir von der Lokomotive heißes Wasser abzapfte. Die Lokomotive fuhr der Chinese.
Ungefähr im Dezember wurde die Wasserleitung fertiggestellt, über einem Trog lag ein Rohr, aus dessen Löchern das Wasser lief. Vor der Einrichtung dieser Waschstelle hatten sich die Kranken überhaupt nicht waschen können. Auch die Fieberkranken mußten sich im Winter draußen waschen.
Ich erinnere mich, dass es auch in der Nähe der Öfen einen Wasserhahn gab. Der wurde entweder aus einem großen Tank oder einem Brunnen gespeist.
Die Latrine bestand aus einem Graben, über dem ein Brett lag. Darunter standen ein paar Holztonnen. Zunächst gab es nur ein Dach, später wurden dann Rück- und Seitenwände angebaut. Anfangs konnte ich diese Toilette, weil sie so widerwärtig war, nicht benutzen. Viele Kranke mußten am Tag bis zu dreißig Mal zur Latrine gehen. Denjenigen, die nicht mehr aufstehen konnten, wurde nicht geholfen. Fand ein Sanitäter sie in ihrem Dreck, wurde ihnen mit einem Wort gedroht, das ich hier nicht wiederholen möchte. Manchmal wurden sie auch geschlagen.
Was ich jetzt berichte, habe ich nicht selber erlebt. Camu hat es mir erzählt: Mein Vater, ein Rechtsanwalt, konnte wegen seines Alters von 52 Jahren nicht draußen arbeiten. Camu fragte deshalb den Laborleiter Hefter, ob mein Vater dort nicht auch arbeiten könne. Der antwortete: „Dieser Rechtsanwalt soll sterben wie ein Hund.“ Mein Vater mußte im Ölschiefertagebau arbeiten. Als er sich einmal ausruhte, denunzierte Hefter ihn bei einem Kapo, der ihn daraufhin verprügelte. Ein paar Tage später wurde er besinnungslos ins Lazarett eingeliefert. Das war Ende Dezember. Auch mein Vater mußte ständig zur Latrine. Als er so geschwächt war, dass er nicht mehr gehen konnte, stahl ich eine Waschschüssel, die ich ihm als Bettpfanne ins Bett schob. Wäre ich nicht auch im Lazarett gewesen, hätte mein Vater wie ein Tier leben müssen. Er starb am 17. Februar 1945 an der Ruhr und an großer Erschöpfung.
Der deutsche Sanitätshelfer gab mir den Befehl, meinen Vater auszuziehen. Früher hatte mein Vater 90 Kilo gewogen. Jetzt war er so abgemagert, dass ich ihn alleine tragen konnte. Ich mußte seine Leiche hinter die Latrine legen. Dort lag sie für einige Tage, bis sie mit anderen Toten zum Friedhof gebracht wurde. Ich sah Leichen, deren Oberschenkel so dünn waren wie Handgelenke.
Beim Transport der Leichen zum nördlich des Lagers gelegenen Friedhofes ging ich mit. Die Körper wurden nackt in Holzkisten geworfen, die schon in einem Loch in der Erde standen. Nach dem Zuwerfen des Grabes mit Erde stellte ich am Grab meines Vaters ein schwarzes Kreuz auf. Darauf hatte ich mit weißer Farbe seinen Namen geschrieben. Dann war die Beerdigung zu Ende. Bevor wir im April Schandelah verließen, ebneten die SS-Leute den Friedhof ein, um Spuren zu verwischen.
Bis November wurden die Toten bis zum Abtransport ins Krematorium nach Drütte hinter der Latrine abgelegt. Gewöhnlich kam einmal pro Woche ein Lkw, der auf der Rückfahrt von Drütte Brot und andere Lebensmittel mit zurückbrachte.
Die Leichen, die ich an der Latrine habe liegen sehen, trugen die Spuren großer Leiden. Ich habe auch die Leichen der zwei Männer gesehen, die erschossen worden waren. Ich bin ziemlich sicher, dass es an einem Tag im Februar passierte. Ihre Namen kenne ich nicht. Ich glaube aber, es waren Gefangene slawischer Herkunft, Russen oder Polen.
Die Körper der Erschossenen lagen so, dass jeder Gefangener, der das Lager verließ, an ihnen vorbei mußte. Ich habe sie mir gut angesehen. Sie lagen mit den Gesichtern nach oben im Dreck. Einschußlöcher habe ich nicht feststellen können.
Ich weiß nicht mehr, ob es mittags oder abends war. Nach der Rückkehr von der Arbeit wurden wir am Lagertor jedes mal gezählt. Dabei wurde festgestellt, dass zwei Gefangene fehlten. Ich sah Truschel weggehen. Etwas später hörte ich Schüsse. Die Leichen wurden dann in einem Zementschuppen gefunden. Nach der folgenden Schicht wurden sie mit ins Lager gebracht. Ich habe Truschel nicht gesehen, wie er einen Revolver in der Hand hielt. Er trug aber immer einen am Gürtel.
Ich wurde einmal von Hefter brutal aus dem Labor hinausgeworfen. Zwar arbeitete ich dort nicht, ging aber manchmal rüber, um mich aufzuwärmen oder um Heizmaterial zu besorgen.
Am 14. November wurde ich das zweite Mal krank, durfte aber nicht ins Lazarett. Weil es mir zunehmend schlechter ging, hatte ich mir an meinem Arbeitsplatz ein kleines Feuer gemacht, um mich warm zu halten. Der Kapo Schmidt erwischte mich, schlug mich zusammen und denunzierte mich auch noch. Als Strafe mußte ich dann im Wald zwischen Schandelah und dem Lager Bäume für die Trasse der Eisenbahn fällen. Vollkommen erschöpft und krank schleppten mich mein Vater und ein Freund zum Sanitäter. Zehn Tage lang hatte ich über 40 Grad Fieber. Der Sanitäter nahm abends meine Temperatur, schickte mich dann aber immer wieder weg. Ende November wurde ich endgültig ins Lazarett aufgenommen, wo ich bis Ende März blieb. Ich hatte eine doppelseitige Lungenentzündung und litt an Typhus und Ödemen. Weil kein Bett frei war, mußte ich eins mit Camu teilen, der Durchfall hatte. In den meisten Betten lagen zwei Gefangene zur gleichen Zeit. Die Betten waren drei Etagen hoch und ungefähr einen Meter breit. Zu zweit konnte man nicht auf dem Rücken liegen, sondern mußte die Zeit in Seitenlage verbringen. Camu und ich lagen ganz oben. Wir hatten einen dünn gefüllten Strohsack, ein kleines ebenfalls mit Stroh gefülltes Kissen und anfänglich nur eine Decke.
Die Decken waren alle völlig verschmutzt. Alle Kranken hatten während des Aufenthaltes im Lazarett nur ein und dieselbe Decke zur Verfügung. Nach der Entlassung wurden sie kurz in kaltes Wasser getaucht und getrocknet. Das war die ganze Reinigung. Ich hatte von November bis März die gleiche Decke. Besonders im Raum der Schwerkranken roch es stark nach Eiter und Verwesung. Aus meinem linken Oberschenkel rann literweise Eiter. Die Wunden wurden mit schwarzer Salbe bestrichen. Weil die Papierbinden nur alle drei Tage gewechselt werden konnten, waren meine Strohmatte und meine Decke stark verschmutzt. Ab und zu erhielt ich Aspirin-Tabletten, oder mir wurde Chinin verabreicht. Damals lagen 86 Kranke im Lazarett. Im Dezember und Januar stieg die Zahl auf über 100 an. Ende Februar waren es 120. Jede Woche wurden 10 bis 15 Kranke wieder an die Arbeit zurückgeschickt. Die Entscheidung darüber fiel der Sanitäter oder einer seiner Helfer. Zwischen November und März starben 130 Menschen.
Das Essen im Lazarett war das gleiche wie für die anderen Gefangenen. Nur die Schwerkranken bekamen eine etwas bessere Suppe. Während meines Aufenthaltes im Lazarett erhielten wir vier Pakete vom belgischen Roten Kreuz. Der Inhalt wurde auf alle Patienten aufgeteilt.
Es lagen hier auch Kranke mit ansteckenden Krankheiten, z.B. Typhus und Tuberkulose. Die Eßgeschirre wurden von einem Patienten zum anderen weitergereicht, nachdem sie nur mit kaltem Wasser abgewaschen worden waren. Nicht einmal die elementarsten Grundlagen der Hygiene wurden berücksichtigt.
Ende November war das Lager von einer großen Ungezieferplage befallen. Weil wir uns nicht richtig sauber halten konnten, waren wir schon bald mit Flöhen übersäht. Ich habe im Lazarett einen Italiener gesehen, der unter seinen Armen und am Bauch Millionen von Läusen hatte. Man konnte sie mit vollen Händen entfernen. Es hat nie den Versuch gegeben, im Lazarett die Betten, Strohsäcke und Kleidungsstücke zu desinfizieren. Ab und zu wurde etwas Paraffin auf Kranke gestäubt, das gleiche, das für die Reinigung der Fußböden benutzt wurde. Weil ich keine Seife bekam, stahl ich mir ein Stück. Das war allerdings steinhart. Taschentücher oder Handtücher haben wir ebenfalls nie erhalten. Nach dem Waschen trockneten wir uns mit unserer Kleidung ab.
Weil es im Lager keinen ständigen Arzt gab, kam ab und zu Dr. Zschirpe aus Schandelah ins Lazarett. Er schaute sich nur kurz um und überprüfte die hygienischen Verhältnisse. Nachdem er sich die Toten angesehen hatte, fuhr er wieder weg. Meines Wissens hat er nie einen Kranken untersucht. Er wurde immer vom Sanitäter begleitet.
Dieser Sanitäter war von Beruf Maurer und hieß Napp. Er war auch ein Gefangener. Napp hatte drei Assistenten, einen französischen Medizinstudenten, einen deutschen Masseur und einen anderen Deutschen, der von Beruf Straßenhändler war.
Mit einem Skalpell, das er mit in der Autowerkstatt gestohlenem Benzin desinfizierte, führte Napp auch Operationen durch. Das geschah immer ohne Betäubung. Die Patienten wurden entweder festgehalten oder am Tisch festgebunden.
Persönlich habe ich es bewundert, wie er arbeitete, es geschah allerdings planlos und nur aufs Geratewohl. Seine Operationen führte er hauptsächlich an Kranken durch, die schon fast tot waren. Im Januar 1945 operierte er einen Jugoslawen, der zwar sehr dünn war, aber dessen Bauch stark aufgeblasen war. Napp öffnete den Bauch, entfernte den Eiter und nähte die Wunde wieder zu. Ich werde bis an mein Lebensende nicht vergessen, wie der Jugoslawe drei Tage später – die jugoslawische Nationalhymne singend – endgültig starb.
Ich habe in Schandelah Krankheiten gesehen, von denen ich vorher nichts gewußt habe. Die kleinste Verletzung konnte sich hier innerhalb von Tagen zu einer hocheitrigen Wunde entwickeln. Unter diesen Lebensbedingungen schwollen manchem Gefangenen die Beine so an, dass sie eher Elefantenbeinen glichen. Einmal sah ich, wie Napp ein Bein öffnete. Viel Wasser floß heraus. Kurze Zeit später war die Wunde voller Eiter.
Ein anderes Mal beobachtete ich, wie ein Lette ins Lazarett eingeliefert wurde. Die Kapos Schmidt und Spinrath hatten ihn im Kleiderlager verprügelt, weil man bei ihm ein Messer gefunden hatte. Sein Rücken war übersäht mit faustgroßen Wunden. Ein anderer Lette ist, weil er auch ein Messer besessen hatte, ermordet worden. Im Lager lief das Gerücht um, Truschel hätte das getan.“
Heimatgeschichtliches Archiv
von Jürgen Kumlehn